Basic HTML-Version
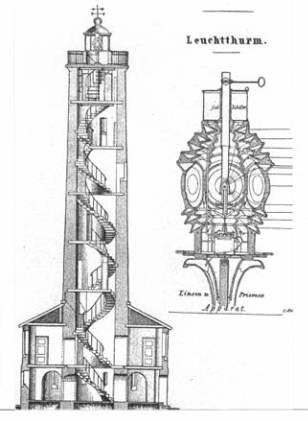


Die ursprünglichen Lichtquellen der Leuchttürme: Holzfeuer
– Kerzenlaternen – Kohlenblüsen – Öl – oder Petroleum-
lampen – Gas – Glühlicht – führten letztendlich zu elektrisch
betriebenen Leuchten. Dabei verlief der Weg von der Glüh-
über Lichtbogen- zur Xenon- Hochdrucklampe.
Im Lauf der Jahre wurden unterschiedliche optische
Systeme zur Lichtverstärkung entwickelt. Auf den
Parabolspiegel mit Argand-Lampe folgte der Einsatz von
Fresnel-Linsen und führte schließlich über die
Scheinwerferlinse zur sog. Lichtkanone. Diese arbeitet
nach dem Kino-Projektionsverfahren und eignet sich mit
ihrem scharf begrenzten Strahl von hoher Lichtstärke als
Präzisions-Sektorenfeuer. Während ein Parabolspiegel mit
Argand-Lampe eine Reichweite von ca. 15 km hatte, kön-
nen mit einer Lichtkanone immerhin 60 km überbrückt wer-
den.
Die ersten Leuchtfeuer strahlten ihr Licht gleichmäßig und
ununterbrochen aus. Mit zunehmendem Schiffsverkehr
wurde es dann nötig, jedem Leuchtturm seine eigene
Kennung zu geben. Diese besteht aus Lichtblitzen in
bestimmten Abständen und von genau festgelegter Dauer.
Eine eigens dafür konstruierte Maschine ließ anfangs
Blenden um die Lichtquelle rotieren und erzeugte so die
Blitzgruppe. Später sorgten elektronische Taktgeber für
den Rhythmus. In früherer Zeit waren die Leuchttürme mit
Menschen besetzt, die sich um das Funktionieren der tech-
nischen Anlagen kümmern mussten. In den meist einsam
Leuchtturm von
Wangerooge 1856.
Daneben: Fresnellinsen

